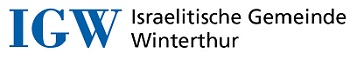Presse
AUFZEICHNUNGEN. LEBEN IM GHETTO UND BEGEGNUNGEN IN DEN JAHRZEHNTEN DANACH von ROMAN VISHNIAC
Pressemitteilung
Eine Sommerausstellung in der COALMINE, in Zusammenarbeit mit der Fotostiftung Schweiz
28. August bis 10. Oktober 2015
Vernissage: Donnerstag, 27. August 2015, 18.30 Uhr
«In Krakau war ich zum letzten Mal 1938. Ich stand draussen im Schneeregen, und alte Legenden und Geschichten rieselten auf mich herab. Vor meiner Reise nach Krakau hatte ich einiges über das Leben der Juden im Mittelalter gelesen. Was hatte sich verändert in einem halben Jahrtausend?… Ich stand auf dem Platz, ein alter Gelehrter ging langsam vorbei, wie ein biblischer Patriarch sah er aus. Er schien müde. Er tat mir leid, und ich fragte ihn, wie lange er schon unterwegs sei. ‹Seit alles begann›, war die Antwort. Ich fragte nicht, wie er das meinte.» Roman Vishniac
Roman Vishniac appelliert an unser Mitgefühl. Zunächst zog er im Auftrag eines jüdischen Hilfsvereins los und dokumentierte den jüdischen Alltag in verschiedenen osteuropäischen Städten zwischen den Weltkriegen. Dieser Aufgabe hat er sich mit unermüdlicher Energie, einem differenzierten Blick und einer vorbehaltlosen Empathie verschrieben. Er schuf ein einzigartiges historisches Konvolut von Bildern, aus denen uns immer wieder dunkle Augen entgegenfunkeln – von greisenhaften Kindern, von Frauen in russgeschwärzten Küchen, von Familien in überfüllten Kellerwohnungen oder von vorbeihastenden Rabbinern. Doch es gibt auch indirekte Begegnungen. Einige verschwinden beinahe zwischen Möbeln, Mauern oder unter den Lasten, die sie mangels Pferd und Karren selbst durch die Strassen schleppen. Es sind prekäre Existenzen und Gemeinschaften, die Vishniac ins Bild gebannt hatte. Und zwar mit einer klaren Vision: Die berührenden Nahaufnahmen sollten die Weltöffentlichkeit aufrütteln und die sich anbahnende Katastrophe verhindern. Rückblickend stellen wir fest: Das Rad der Geschichte konnte Vishniac nicht aufhalten, doch sein Plädoyer für Empathie und Menschlichkeit hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Wer vor seinen ikonischen Aufnahmen steht und seine knappen erläuternden Kommentare dazu liest, wird diese Bilder nicht mehr vergessen.
Roman Vishniac wurde am 19.8.1897 in der Nähe von St. Petersburg geboren und wuchs in Moskau als Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamile auf. Als Kind erhielt er ein Mikroskop und eine Kamera geschenkt – zwei Medien, die er sofort kombinierte und die ihn zeitlebens begleiteten. Nach dem ersten Weltkrieg zog die Familie nach Berlin, so auch das junge Paar Roman und Luta Vishniac. Von hier aus beobachtete er den in den benachbarten Ostländern erstarkende Antisemitismus, bis er auf Bitte des Berliners Büros des ‹Hilfsvereins der deutschen Juden› 1935 erstmals nach Osteuropa reiste. Die in den kommenden vier Jahren in Polen, der Karpato--Ukraine, der Slowakei und Ungarn teils mit verborgener Kamera geschossenen Aufnahmen sollten dazu dienen, Mittel zur Unterstützung der verarmten Gemeinden aufzubringen. Die Porträts spiegeln Vishniacs eigenes Erleben, das er nach einem Besuch in Bratislava (damals Pressburg) 1938 wie folgt schildert: «Geschichten und Legenden stiegen aus vergangenen schrecklichen Zeiten auf: Progrome, Brandstiftungen, Ausweisungen – Massaker, denen ganze Judengemeinden zum Opfer fielen. Mein Begleiter erzählte, und die Tragödien schienen an den Häusern und Plätzen zu haften.»
Die Reihe dieser Aufnahmen bricht mit Vishniacs Internierung in Frankreich ab, bevor er 1941 in die USA emigrieren konnte. In den folgenden Jahren verschrieb er sich der Veröffentlichung der Bilder, in der Hoffnung, damit den Krieg verhindern zu können. Parallel schuf er die heute weltweit bekannten Porträts von Albert Einstein, Marc Chagall sowie mikrofotografische Aufnahmen für die Zeitschrift Life. Am 22.1.1990 ist Visniac 92--jährig in New York gestorben
Sehr früh – kurz nach Vishniacs erster umfassenden Einzelausstellung im International Fund for Concerned Photography in New York 1971 – wurde der vormalige Leiter der Fotostiftung Schweiz, Walter Binder, auf ihn aufmerksam. Er realisierte mehrere Ausstellungen, so 1974 im Stadthaus Zürich und 1982 im Kunsthaus Zürich. Dank seinen freundschaftlichen Verbindungen kamen in der Folge bedeutende Werkgruppen von Roman Vishniac in die Fotostiftung – über Schenkungen von Mara Vishniac Kohn und Gerda Meyerhof sowie über den Nachlass des Filmemachers Erwin Leiser. Damit verfügt die Stiftung heute über eine der grössten Vishniac-- Sammlungen ausserhalb von Amerika. Eine repräsentative Werkauswahl wird nun in der COALMINE gezeigt. Die COALMINE dankt der Fotostiftung für die fachlich kompetente und generöse Kooperation, welche diese denkwürdige Ausstellung erst möglich werden liess.
Die Ausstellung wird von Katri Burri kuratiert und in Kooperation mit der Fotostiftung
Schweiz realisiert.
Sämtliche Werke stammen aus der Sammlung der Fotostiftung Schweiz.
Veranstaltungen
Kulturnacht 2015
Samstag, 12. September, 2015, 17 Uhr, Auftakt zur Kulturnacht 2015
Klezmer und Klassik — Ronny Spiegel, Violine und Michal Lewkowicz, Klarinette
Öffnungszeiten COALMINE Mo -- Fr 8 -- 19 & Sa 11 -- 16 Uhr
Ein Goi hielt das Festreferat

Die Jüdische Gemeinde blickt optimistisch in die Zukunft. Und mit Humor. Gestern haben die Winterthurer ihr renoviertes Betlokal eröffnet.
Es gibt einen Rabbi, den alle kennen. «Rabbi Google» habe er zur Vorbereitung aufgesucht, scherzte Rabbiner Mendel Rosenfeld in seiner Ansprache vor der Israelitischen Gemeinde Winterthur (IGW). Google ergab: «1886 war ein sportliches Jahr.» Nicht nur die IGW sei damals gegründet worden, sondern auch der Grasshoppers Club Zürich und der FC Winterthur – leider eine falsche Datierung, denn Letzterer ist bekanntlich zehn Jahre jünger. Einen weiteren Fehler im Internet machte Rabbi Rosenfeld gleich selbst aus: Die Jüdische Gemeinde in Winterthur stehe «heute mehr denn je im Schatten Zürichs», habe er da lesen müssen.
Gemeinde mit 100 Mitgliedern
Eigenständig und unabhängig von Zürich trifft sich die Gemeinde
seit 60 Jahren im schlichten Betlokal, das nach einer Renovation gestern in Anwesenheit
der Stadträte Stefan Fritschi (FDP) und Matthias Gfeller (Grüne) eröffnet
wurde. Die Stadt und der Hauseigentümer unterstützten die Umbauten finanziell.
Die 14 Bänke reichen aus für die Gottesdienste der Gemeinde, die insgesamt
rund 100 Mitglieder zählt. Diese versammeln sich etwa einmal im Monat. Anders
als in anderen Gemeinden findet kein wöchentlicher Gottesdienst statt –
die IGW besteht aus eher säkularen Juden. «Jemanden mit Bart trifft
man hier kaum», so Co-Präsident Jules Wohlmann.
Kein Grund, die Tradition nicht zu pflegen. Der Toraschrein, Zentrum eines jeden
jüdischen Betsaals, steht an der nach Jerusalem weisenden Ostwand und ist
eine Besonderheit: Der Kopfteil stammt aus dem 19. Jahrhundert. Erarbeitet hat
dessen Geschichte der Gemeinde- und Haushistoriker Peter Niederhäuser. Wohlmann
über ihn: «Er weiss mehr über uns als wir.»
Vergangenheit und Zukunft
Erfreut, als «Goi» (Nichtjude), ein Referat halten zu dürfen,
blickte Niederhäuser zurück zu den ersten Juden in Winterthur. Einer
der einflussreichsten war Jonas Biedermann, der ab den 1840er-Jahren in Veltheim
lebte und in seinem Haus erste gemeinschaftliche Gottesdienste abhielt. Eine Stellungnahme
aus dem Jahr 1859 gibt Aufschluss über die damaligen Verhältnisse: Eine
stadträtliche Anfrage zur Gleichstellung der Juden beantwortete der Stadtrat
ablehnend und mit missbilligendem Unterton.
«Die Juden waren vor allem in jenen Gegenden unbeliebt, in denen man sie
nicht kannte», stellte Niederhäuser die vielleicht gar nicht so historische
Situation dar. «Dass man gleichzeitig Schweizer und Jude sein konnte, das
verstanden viele nicht.» Stadtrat Gfeller blickte darauf in seiner Ansprache
lieber voraus als zurück: Dem «Landboten» habe er erfreut entnommen,
dass die Gemeinde eine Erneuerung des Mitgliederrechts anstrebe. Bisher haben
hauptsächlich Familienväter ein Stimmrecht, Frauen nur als Ledige oder
Witwen. Eine Änderung wäre für Gfeller «das Anerkennen gewisser
Prinzipien des Staates.» Auch Wohlmann ist zuversichtlich. Er erinnerte
die Mitglieder abschliessend, das 250-Jahr-Jubiläum der Gemeinde in 125 Jahren
ja nicht zu verpassen.
Originaler Zeitungsartikel als PDF
Jüdische Gemeinde in jüngerer Hand

Nach 42 Jahren hat Silvain Wyler die Leitung der Israelitischen Gemeinde Winterthur an zwei jüngere Ko-Präsidenten abgegeben. Die beiden Neuen möchten die Gemeinde für neue Mitglieder attraktiv machen und planen bereits die Renovation des Betsaals.
Die Israelitische Gemeinde Winterthur (IGW) hat zwei neue Ko-Präsidenten:
Jules Wohlmann und Shlomy Hermon. Jules Wohlmann ist 64-jährig, verheiratet
und zweifacher Vater. Seine Familie stammt ursprünglich aus dem alten Polen.
Um 1900 sind seine Grosseltern nach Zürich ausgewandert und waren hier als
Schneider und Kaufleute tätig. Wohlmann selbst hat seine Grosshandelsfirma
in der Uhrenbranche vor ein paar Jahren in jüngere Hände gegeben. Seither
engagiert er sich für verschiedene Projekte: Er ist für einen Weinhändler
tätig, der koscheren Wein aus den Golanhöhen importiert. Wohlmann versucht,
den Wein auch an nicht jüdische Weinkenner zu verkaufen.
In seiner Wohngemeinde Oberengstringen ist Wohlmann zudem an einer Aktion beteiligt,
welche das Image des Ortes fördern soll: Wie in früheren Jahren in Zürich,
wo die Bahnhofstrasse mit Kühen, Bären und Blumentöpfen geschmückt
wurde, werden in Oberengstringen ab Mai bunte Windräder in den Strassen aufgestellt.
Shlomy Hermon hat einen anderen Hintergrund: Seine Familie stammt ursprünglich
aus Marokko und ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs nach Israel ausgewandert.
Aufgewachsen ist Hermon in Be’er Scheva, einer Stadt im Süden Israels.
Er liess sich zum technischen Ingenieur ausbilden und war danach vier Jahre im
Militär. Während einer Europareise lernte er seine spätere Ehefrau
kennen, eine Winterthurerin. Für sie verliess er 1990 Israel, liess sich
in Winterthur nieder, seine Frau Marianne konvertierte zum Judentum. Mit ihren
drei Kindern leben sie in Hegi. Shlomy Hermon ist heute 49 Jahre alt und arbeitet
als Techniker bei Kodak.
Viel Arbeit wartet auf die zwei
Hermon ist Mitglied der IGW, seit er in Winterthur lebt. Wohlmann war längere
Zeit Mitglied der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. «Sie war mir
aber zu gross, und weil der Anreiseweg etwa gleich lang ist, habe ich nach Winterthur
gewechselt.» Die Motivation, das Präsidium zu übernehmen, lag
für Hermon im Willen, die jüdische Tradition in Winterthur weiterführen
zu können. Wohlmann ergänzt: «Winterthur wird ja immer trendiger,
immer mehr Leute ziehen hierhin. Wir möchten die Gemeinde fit machen für
neu zuziehende jüdische Familien. Ihnen möchten wir etwas bieten können.»
Auf die beiden Präsidenten wartet viel Arbeit. An vorderster Stelle steht
die Renovation des Betsaals hinter dem Technikum: Die Teppiche werden erneuert,
die Möbel restauriert, Wände gestrichen. Ende Mai soll diese Arbeit
bereits abgeschlossen sein. Die Planung einer eigenen Synagoge sei gegenwärtig
kein Thema: «Wir fühlen uns hier sehr wohl», sagt Hermon. In
Frage kommt hingegen eine Neuerung im Wahl- und Stimmrecht: Die rund 60 Mitglieder
der IGW sind hauptsächlich Familienväter, während die Frauen nur
als Ledige oder Witwen ein Stimmrecht haben. «Es gibt Bestrebungen, dies
zu ändern», sagt Wohlmann. «Wir werden dies dem heutigen Zeitgeist
anpassen.» So sollen alle Mitglieder stimmen können.
Der Alltag der beiden neuen KoPräsidenten ist unterschiedlich stark vom Judentum
geprägt. Hermon betet jeden Morgen und fährt jeden Sabbat nach Zürich
für das Samstagsgebet. Seine Familie isst stets koscher. Wohlmann sieht die
Essensregeln etwas weniger eng. Und in den Zürcher Gebetszirkel am Dienstagabend
geht er oft nur, weil ein jüdischer Gottesdienst nur dann möglich ist,
wenn zehn Männer anwesend sind: «Die neun anderen sind froh, wenn ich
auftauche.» Auch sein Engagement für die IGW sei nicht primär
eine Frage des Glaubens, sondern der Solidarität.
Originaler Zeitungsartikel als PDF